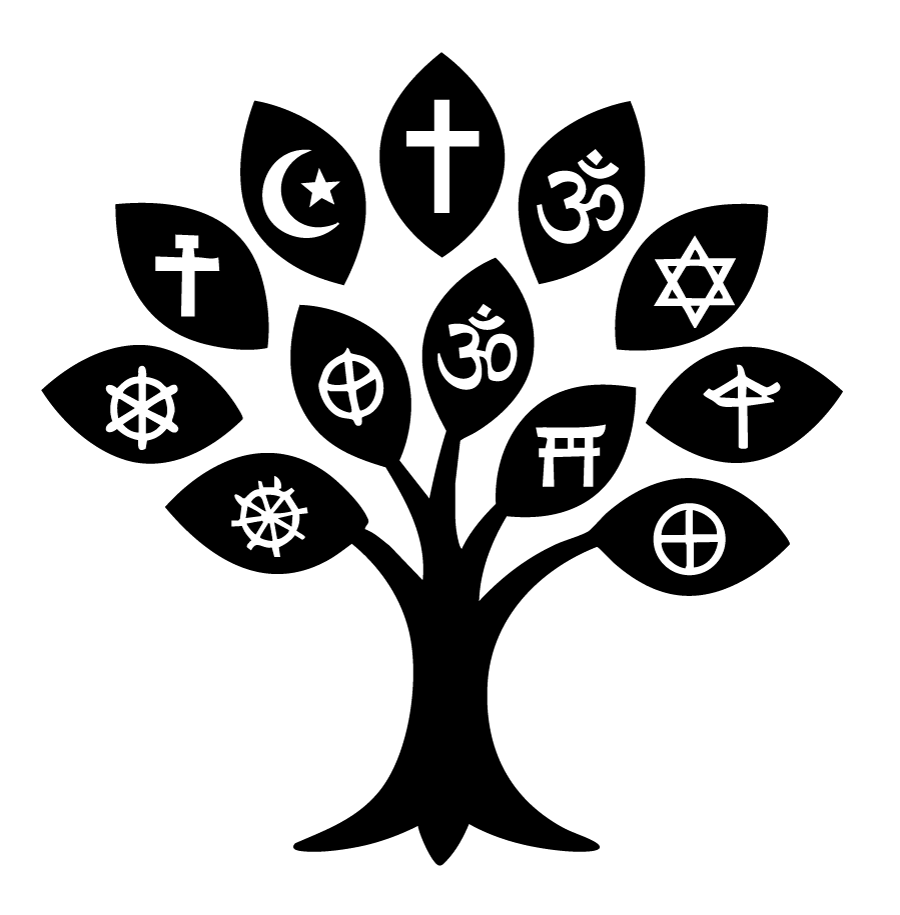Im Mittelpunkt von RuR stehen die SchülerInnen, ihr Leben und ihr Glaube.
RuR wendet sich dem Glauben der SchülerInnen zu, wie er sich im Laufe der Geschichte der einzelnen Religionen und Kirchen/Konfessionen entfaltet hat und von ihnen in der Gegenwart gelebt wird.
Die Lebens-, Glaubens- und Welterfahrungen der SchülerInnen und der Religionslehrpersonen werden im RuR aus der Perspektive des Glaubens der einzelnen Religionen und Kirchen/Konfessionen, zudem in säkular-/weltanschaulicher Perspektive reflektiert und gedeutet.
RuR trägt so dazu bei, dass die SchülerInnen…
- sich selbst besser verstehen;
- die zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen sie leben, wahrnehmen;
- sich in Kultur und Gesellschaft zurechtfinden;
- sich auf die Wurzeln und die Eigenart der Glaubensgemeinschaften besinnen;
- Toleranz gegenüber Neuem und Anderem/Fremdem entwickeln;
- ihren Glauben gemeinsam mit anderen leben und feiern.
So werden die RuR-SchülerInnen bestärkt, ihre persönlichen Entscheidungen zu treffen und zu verantworten und ihr Leben und ihren Glauben oder ihre säkular-weltanschaulichen Optionen entsprechend zu gestalten.
Damit leistet RuR einen wesentlichen Beitrag zur Sinnfindung, zur religiösen Sachkompetenz, Friedensfähigkeit und zur Werte- und Moralerziehung der SchülerInnen.
RuR trägt aktiv dazu bei, das Schulleben insgesamt positiv zu beeinflussen.
RuR möchte, dass die SchülerInnen mit sich selbst, mit ihrem Glauben und mit ihrer eigenen Religions- oder Kirchen-/Konfessionszugehörigkeit besser vertraut werden. Die Auseinandersetzung der SuS-SchülerInnen mit ihrer eigenen Herkunft und ihrer Religions- oder Kirchen-/Konfessionszugehörigkeit leistet einen Beitrag zu ihrer Identitätsbildung, so dass auch eine unvoreingenommene und angstfreie Öffnung gegenüber anderen Religionen und Kirchen erleichtert wird.
Dies erfordert eine ausführliche Beschäftigung der SuS-SchülerInnen mit anderen Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Trends, die heute – vielfach konkurrierend – unsere pluralistische Welt prägen. Es geht sowohl um eine Befähigung zu Toleranz gegenüber Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen als auch um die Kompetenz zu sachlich begründetem Einspruch dort, wo er erforderlich und angebracht ist.