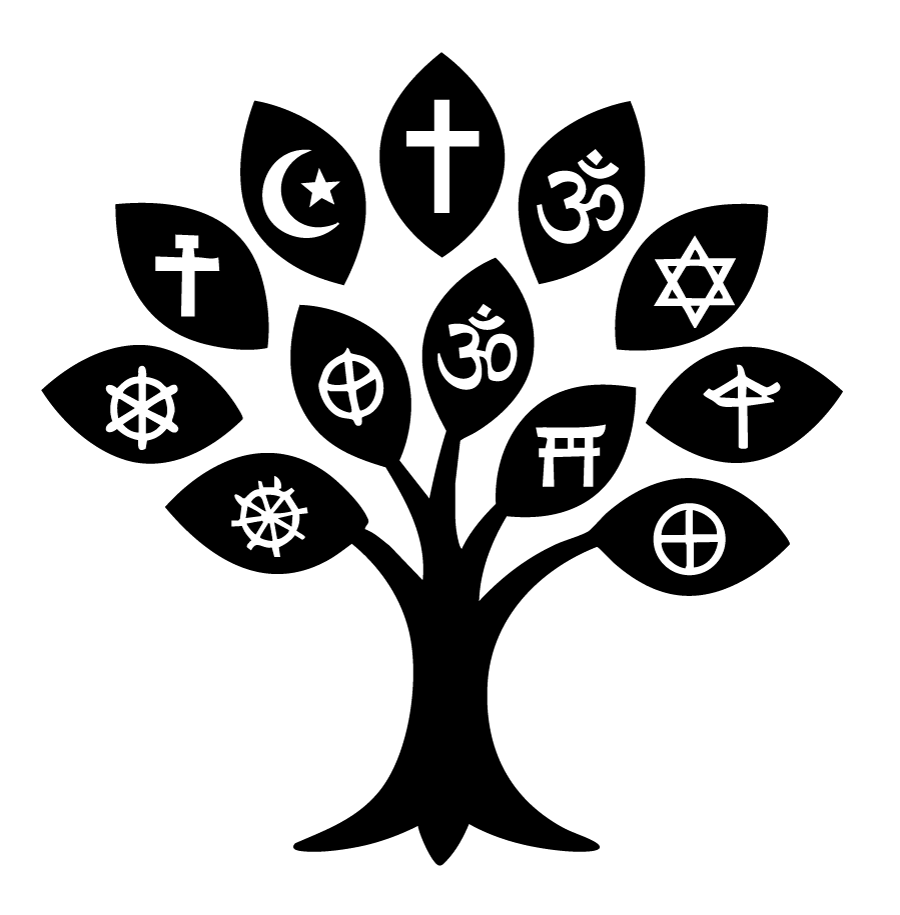RuR bezieht die authentisch gelebten Glaubensformen und das theologisch-glaubensreflektierende Denken (je neu) aufeinander.
In RuR begegnen den SchülerInnen die religiösen, kirchlich-/konfessionellen oder säkular-/weltanschaulichen Lebensauffassungen kulturell kontextualisiert und in größtmöglicher Authentizität, indem deren jeweiliges Selbstverständnis immer auch innenperspektivisch thematisiert wird. Der ausschließlichen Außenperspektive einer bloßen Religionskunde oder einer synkretistischen Einheitsreligion oder einer monolithischen Säkularisation ist damit eine Absage erteilt.
In RuR werden also die Gemeinsamkeiten der Religionen und Kirchen/Konfessionen und säkular-/weltanschaulichen Lebensauffassungen benannt, keineswegs aber deren Unterschiede verwischt. Und die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Religionen, Kirchen/Konfessionen und säkular-/weltanschaulichen Lebensauffassungen werden sichtbar gemacht, keineswegs aber deren Gemeinsamkeiten geleugnet. Beides, Eigentümliches und Gemeinsames, erschließt sich den RuR-SchülerInnen vor allem in Erfahrung, Gespräch und Dialog.
Die Religionen, Kirchen/Konfessionen und säkular-weltanschaulichen Lebensauffassungen begegnen den RuR-SchülerInnen ursprünglich und authentisch, etwa durch Vor-Ort-Erkundungen, Unterrichtsbesuche von Religions- und Kirchen-/Konfessionsangehörigen und durch originale Materialien.
RuR arbeitet sowohl klischeeartigen Vorurteilen als auch den Haltungen distanzierter Unnahbarkeit oder unterscheidungsfreier Beliebigkeit entgegen. Gelebte Glaubenspraxis und authentische Begegnungen werden auch dem theologisch-glaubensreflektierenden und säkular-philosophischen Denken gegenständlich gesetzt, um Missverständnisse und fundamentalistische Vereinnahmungen zu vermeiden.
Inhalte, Lernformen und Intentionen von RuR werden religionspädagogisch, theologisch-glaubensreflektierend und säkular-philosophisch verantwortet, zudem religions-, geistes- und sozialwissenschaftlich gerechtfertigt.
An die Stelle solcher Bezüge und Referenzen setzt Nietzsche – Nichts. Sein Wille ist ein vollständig selbstbezogener Wille, von ihm betitelt etwa als ein Wille zur Macht. Ein Wille, wie er von Nietzsche in der berühmten Parabel vom tollen Menschen angezeigt wird. Dieses Bild Nietzsches vom ‚tollen Menschen‘, der am hellen Vormittag eine Lampe anzündet, stilisiert diesen innerhalb des Motivkreises des antiken griechischen Kynikers Diogenes (ca. 400 -323/24 v. Chr.). Von ihm geht die Anekdote, er habe ebenfalls des Mittags eine Lampe entzündet. Und toll und töricht ist der Mensch in jener Parabel insofern, als dass er absieht von jeglichen Begrenzungen seines Tuns und Wollens. Nichts, was ihn beschränken könnte, nichts, was nicht er selbst wäre. Der tolle Mensch sieht ab von allem, was nicht er selbst ist. Er verzichtet auf die kulturell-geschichtlich verankerten Legitimationsinstanzen Kirche, Staat und Religion. Er verzichtet auf die rationalen Legitimationsinstanzen Vernunft, Philosophie und Theologie. Erst ein solch toller Mensch sei ein freier Mensch. Und als dieser ließ ihn Nietzsche den Tod Gottes verkünden. Es ist dies ein Tod Gottes, der nicht ergeht im Namen der Vernunft, sondern der ergeht in kraft des Willens und nur des Willens.
Nietzsche verkündet mit ihm und betreibt mit ihm den Ausfall und die Nichtigkeit jeder philosophischen oder theologischen Instantialität eines Absoluten. Er betreibt den Entfall einer jeden Geltungs- und Normierungsinstanz, von der menschliches Sein und Handeln abhängig wäre oder seine Rechtfertigung zu empfangen hätte. Nietzsches toller Mensch fordert auf, zusammen mit diesen Instanzen auch jeden Wunsch, jedes Bedürfnis nach Instantialität zu verwerfen. Denn ein solches Bedürfnis ist fehlgeleitetes Bedürfnis, ist fehlgeleiteter, verführter, verschmutzter, unreiner Wille. Das Kant’sche Zugeständnis an ein metaphysisches Bedürfnis im Menschen – für Nietzsche nur eine weitere Form versklavten, ausgeschalteten Willens. Ein Bedürfnis, das den Menschen versklavt und ein Bedürfnis, das der menschlichen Versklavung entspringt, der Sklavenmoral. Gepredigt von den Ordnungsinstanzen einer dekadenten Gesellschaft, zuvorderst einer dekadenten Religion, einer willens- und lebensfeindlichen Kirche, einer bürgerlichen Christenheit. An deren Stelle und an die Stelle all dessen, was den Menschen versklavt, tritt der ‚Übermensch‘, tritt das höhere Menschentum.
Für Nietzsche ist klar: Gegen die Theologen, aber auch gegen all jene, welche die Existenz Gottes atheistisch leugnen, ohne darin die Konsequenzen dieser Leugnung, dieses Todes Gottes – ohne die Konsequenzen des Todes der Vernunft und der Geburt des unmittelbaren Willens und Lebens – zu erfassen und zu bejahen, muss der Blick für die unerschwinglichen Höhen solchen Willens und Lebens geöffnet und wachgehalten werden. Wachgehalten werden muss das Wissen um die Herausforderungen, vor die sich ein Leben gestellt sieht, das im Ausschluss aller Instantialitäten lebt und leben will. Eines Lebens nämlich, das frei ist und aus sich stark, das autonom ist, das keine Gesetze seines Handelns anführen kann noch anführen will. Eine Autonomie, der – anders als bei Kant – keine Gesetze inhärieren. Es gelte, als Mensch zu leben, ohne irgendwelcher (gar absolut gesetzter) Legitimations-, Kausal- oder Gesetzesinstanzen des Lebens, des Denkens, des Handelns zu bedürfen.
Von diesem Tod Gottes zu wissen, ihn zu bejahen und zu wollen – das ist fürwahr ein Leben in der trostlosen Leere des ausgetrunkenen Meeres, im aussichtlosen Lebensraum des weggewischten Horizontes, im bodenlosen Nichts der von der Sonne losgeketteten Erde. Aber es ist ein starkes Leben, es ist ein Leben des Willens und nur des Willens. Es ist ein Leben, das bei sich ist, das bejaht und will. Eine heroische Aufgabe, eine Aufgabe, zu groß für einen Menschen; eine Aufgabe für den Übermenschen. Nur er ist der Freiheit fähig und des Willens. Nur er ist Ich. Wer Nietzsches „Parabel vom tollen Menschen“ hört, erfährt das Erschreckende der Nachricht. Die Nachricht (die Rede) ist nicht nur Nachricht über etwas (über das Erschrecken angesichts des Todes Gottes). Sondern sie ist zugleich ein Teil des Schreckens, den sie verkündet. Sie nimmt und gibt Anteil an dem Tod, den sie verkündet – und sie gibt Anteil an der Geburt des Willens, die sie verheißt.
Nietzsche weiß aber auch, dass seine Rede zu früh kommt, dass die Nachricht noch nicht verstanden ist. Denn die Menschen fliehen der Schrecken, sie fliehen dem Willen, sie fliehen der Freiheit und dem Übermenschen. Sie fliehen dem Ich. Sie können nur ‚kleine Menschen‘ sein, ‚Erdenflöhe‘.